Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Wirtschaft
Das Inflationsgespenst ist nicht surreal
 Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank
Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank
Die Notenbanken pumpen zu viel Geld in die Volkswirtschaften und gerade jetzt beginnt eine große demografische Wende. Dies dürfte in ein paar Jahren zu einem deutlichen Anziehen der Inflation führen.
Seit Ausbruch der Corona-Krise finanziert die EZB mit ihren Anleihekäufen die gesamten Haushaltsdefizite der Euro-Staaten. Die geben das Geld rasch aus und bringen es in Umlauf. In der Folge steigt die breit gefasste Geldmenge M3 um mehr als zehn Prozent. Weil der Kredithunger der Staaten hoch bleibt und die EZB ihn weiter stillt, wird auch in den kommenden Jahren zu viel Geld in Umlauf kommen.
Anzeige
Die Erfahrung der USA in den 60er-Jahren zeigt, dass ein Zuviel an Geld die Inflation früher oder später anfacht. Damals hatte die US-Regierung viele teure Vorhaben wie den Vietnam-Krieg zu finanzieren. Die Notenbank unterstützte das Finanzministerium dabei, indem sie Staatsanleihen kaufte. Die Geldmenge wuchs zu stark. Als sich Mitte der 60er-Jahre Vollbeschäftigung einstellte und die Arbeitnehmer höhere Löhne durchsetzen konnten, entlud sich der Geldmengenüberhang. Die Inflation, die damals wie heute lange unter zwei Prozent gelegen hatte, begann zu steigen. Anfang der 1970er-Jahre, also weit vor dem Ölpreisschock von 1973, lag sie schon bei annähernd fünf Prozent; später wurde sie zweistellig.
Ein naheliegender Einwand ist, dass sich die Weltwirtschaft mittlerweile grundlegend verändert hat und selbst die sehr lockere Geldpolitik die Inflation nicht mehr anschieben kann. Ein Blick auf Osteuropa zeigt aber etwas anderes. In Polen, Tschechien und Ungarn hat der unterliegende Preisauftrieb in den vergangenen Jahren merklich zugenommen. Die expansive Geldpolitik hat in diesen Ländern die Konjunktur angeschoben und Arbeit knapp werden lassen. Die Arbeitslosenquote ist in allen drei Ländern von durchschnittlich zehn Prozent im Jahr 2013 auf gut drei Prozent vor dem Ausbruch der Corona-Krise gefallen. Die zunehmende Knappheit an Arbeitskräften schob ab 2017 die Arbeitskosten spürbar an, was die Inflation steigen ließ.
Was in einzelnen osteuropäischen Volkswirtschaften bereits Realität ist, könnte sich langsam auch auf globaler Ebene entwickeln: nämlich eine inflationstreibende Knappheit an Arbeitskräften. Denn in Asien, Europa und Nordamerika vollzieht sich ein großer demografischer Umbruch. Nachdem der Anteil der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter seit den 1960er-Jahren kontinuierlich gestiegen ist, dürfte er in den kommenden Dekaden deutlich fallen. Damit müssen weniger Arbeitnehmer mit den von ihnen produzierten Gütern und Dienstleistungen mehr Kinder, Jugendliche und Rentner versorgen. Das Güter-Angebot wird verglichen mit der Nachfrage knapper. Zusammen mit dem Zuviel an umlaufendem Geld spricht dies für ein deutliches Anziehen der Inflation.
Die Frage ist nicht, ob die Inflation steigt, sondern wann das geschieht. In den kommenden vier, fünf Jahren dürfte die Inflation im Euroraum noch niedrig bleiben. Dafür spricht zunächst die Corona-Krise. Sie hat die Arbeitslosigkeit in den meisten westlichen Ländern deutlich steigen lassen, was wegen der schwachen Verhandlungsposition der Arbeitnehmer für kaum steigende Arbeitskosten spricht. Außerdem setzt der große demografische Umbruch nur langsam ein; seine inflationstreibende Wirkung könnte zusätzlich dadurch verzögert werden, dass weitere ärmere Länder in die globale Arbeitsteilung integriert werden.
Aber je weiter man in die Zukunft schaut, desto wahrscheinlicher wird ein Anziehen der Inflation. Dann dürfte es an den globalen Finanzmärkten ungemütlich werden. Denn die meisten Anleger erwarten noch immer, dass die Inflation und die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben. Wenn sich diese Erwartungen als falsch herausstellen, kämen die hoch bewerteten Aktien, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen unter die Räder. Von einem solchen Szenario würden nur wenige Anlageformen profitieren, darunter natürlich Gold.
Bild: Commerzbank AG
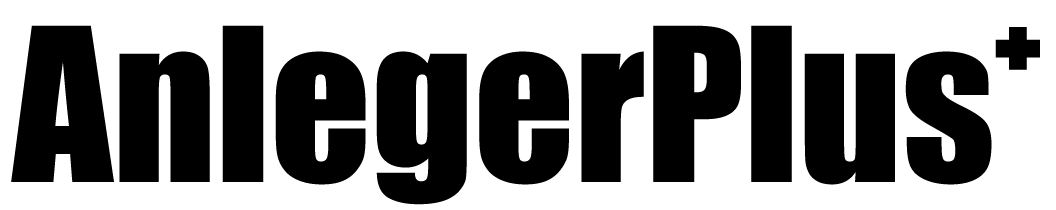
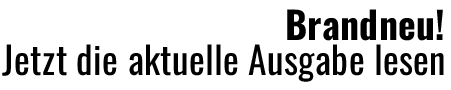


 Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank
Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank


