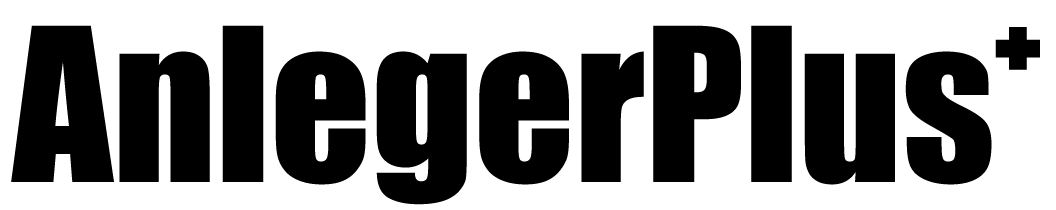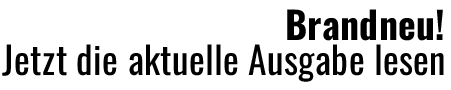Wirtschaft
Für wenige, viele und manchmal (r)evolutionär
In der merkantilistischen Epoche (16. bis 18. Jahrhundert) versuchte der Staat, gezielt auf Binnenwirtschaft und Außenhandel einzuwirken. Von solchen Eingriffen hielten weder die Physiokraten noch Adam Smith viel. Mit dem Marxismus erhob sich dann die nächste Gegenbewegung.
Merkantilistisches Denken entwickelte sich mit der in Europa vorherrschenden Regierungsform des Absolutismus, der Entdeckung neuer Welten sowie dem Aufblühen des Fernhandels. Die Stützen hierfür waren eine Armee und der Beamtenapparat, die jedoch finanziert werden mussten. Geld war also knapp und sollte vor allem über Exportüberschüsse ins Land kommen.
Zum Wohl des Staates
Die merkantilistische Wirtschaftspolitik förderte Exporte u. a. mit Ausfuhrprämien und beschränkte Importe durch Handelshemmnisse wie etwa Zölle. Rohstoffe sollten möglichst nicht exportiert werden und wurden meist aus den Kolonien eingeführt. Zudem setzten die Merkantilisten auf einen starken Binnenmarkt, in dem inländische Zölle sowie Zunftprivilegien abgeschafft, Maße vereinheitlicht und Infrastruktur ausgebaut, aber auch inländische Monopole gefördert wurden. Die „Arbeitsmarktpolitik“ war ausgerichtet auf niedrige Löhne durch Bevölkerungswachstum und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die merkantilistische Wirtschaftspolitik hatte stets das Ziel vor Augen, die Macht des Staates und seines Herrschers mit gut gefüllter Staatskasse zu stärken.
Während sich viele europäische Staaten dabei auf den Handel und das Gewerbe konzentrierten, förderte die deutsche Variante des Merkantilismus – der Kameralismus – auch die Landwirtschaft, um vor allem die verwüsteten Landstriche nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder aufzubauen. Außerdem waren durch den Krieg die Staatskassen der deutschen Fürstentümer geplündert.
Mit François Quesnay traten dann die Physiokraten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Erscheinung, die zum ersten Mal Produktion, Verteilung und Verwendung schematisch als Wirtschaftskreislauf darstellten. Die Physiokraten, deren Name aus dem Altgriechischen abgeleitet für Herrschaft der Natur stand, waren überzeugt, dass Wohlstand nur durch die Arbeit des Landwirts entstünde und staatliche Eingriffe in diesen Wirtschaftskreislauf zu Störungen führen würden.
Wirtschaftspolitisch forderten sie im Gegensatz zu den Merkantilisten Freihandel und die Abschaffung der Monopole sowie eine Steuerreform, mit der auch die fiskalischen Privilegien des Adels und Klerus fallen sollten.
Zum Wohle vieler
Auch Adam Smith (1723–1790), der Begründer der klassischen Wirtschaftstheorie, kritisierte die merkantilistische Wirtschaftspolitik. Nicht die Anhäufung von Edelmetallen und Geld erzeuge Reichtum, sondern die Arbeitsteilung und ihre höhere Produktivität. Bekannt ist bis heute seine Metapher der „unsichtbaren Hand“. Indem jeder sein Eigeninteresse verfolge, sorge sie für das Wohle vieler, ohne dass es den Staat als zentrale Instanz bräuchte.
Allerdings nicht immer. Dann sollte der Staat den institutionellen Rahmen setzen. Dazu zählten für Smith die Schulausbildung, innere sowie äußere Sicherheit, Rechtsetzung sowie Rechtsprechung und Infrastruktur – beispielsweise Straßen. Außerdem müsste die Bildung von Monopolen und Kartellen (z. B. Zünfte) verhindert werden. Auch der Bankensektor galt schon damals als instabil und sollte folglich maßvoll reguliert werden.
David Ricardo (1772–1823) brach mit seiner Theorie der komparativen Vorteile im Außenhandel endgültig eine Lanze für den Freihandel. Dazu wählte er als Beispiel zwei Länder, die beide in der Lage wären, jeweils zwei Güter zu produzieren. Auch wenn ein Land beide Güter effizienter produzieren könnte als das andere, lohne sich eine Spezialisierung. Die Wirtschaftspolitik der Klassik war also in erster Linie Ordnungspolitik.
Zum Wohl der Arbeiterklasse
Als Vulgärökonomie bezeichnete wenig später ein deutscher Ökonom und Philosoph die klassische Wirtschaftstheorie. Diese sei in der Ideologie gefangen, dass der Kapitalismus eine unveränderliche Produktionsweise, quasi ein Naturgesetz, wäre. Karl Marx (1818–1883) vertrat die Ansicht, nur die Arbeit würde Werte schaffen. Der Kapitalist würde sich aber kontinuierlich einen Anteil aneignen. Dies und der Konkurrenzkampf sorgten letztlich dafür, dass immer mehr Kapital bei einigen wenigen akkumuliert werden würde. Daraus entstünden ökonomische Krisen und soziale Spannungen, aber die Gesellschaft würde sich weiterentwickeln.
Die größte Wirkung zeigten die Marxistischen Wirtschaftstheorien auf politischer Ebene, indem sich sozialistische Regimes auf sie beriefen. Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen pendelten zwischen Sozialreform oder Revolution. Einige Widersprüche sah auch Rosa Luxemburg (1871–1919) in den Theorien von Karl Marx und erweiterte diese mit ihrer Imperialismustheorie. Der zufolge könnte nur die Erschließung neuer Märkte (u. a. in den Kolonien) dem Kapitalismus eine Galgenfrist verschaffen. Damit stellte sie sich zugleich gegen die merkantilistische Wirtschaftspolitik, welche billig Rohstoffe aus den Kolonien bezog und diese wiederum zwang, ihre Fertigwaren zu importieren.
Spätestens Bucharin, ein russischer Wirtschaftstheoretiker, verabschiedete sich vom Gedanken, dass der Weg in die klassenlose Gesellschaft evolutorisch stattfinden könnte. Als Weggefährte Lenins unterstützte er aber 1921 dessen „Neue Ökonomische Politik“ für Russland, welche in einer Übergangszeit freie Marktwirtschaft und Zentralplanwirtschaft kombinierte, um dort den wirtschaftlichen Niedergang abzufedern. Die Verstaatlichung wurde daraufhin abgeschwächt und der private Kleinhandel wieder zugelassen – ein Hauch von Ordnungspolitik, um parallel dazu die zentralen Planungsorgane aufzubauen.
Bild: © weiXx – istockphoto.com