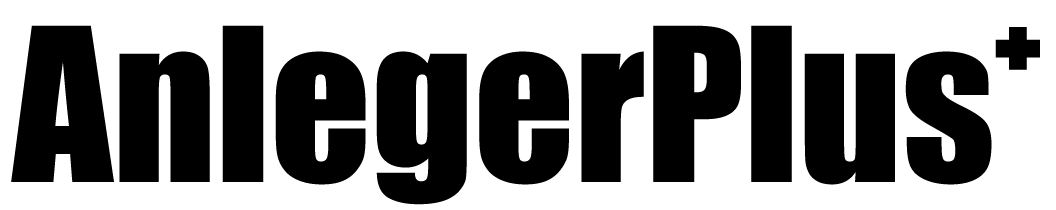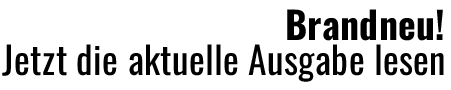Wirtschaft
Ökonomen erobern die Politik
Zwei Ökonomen suchten Antworten auf die Weltwirtschaftskrise 1929 – kamen allerdings zu unterschiedlichen Empfehlungen. Die antizyklische Konjunkturpolitik von Keynes erreichte vor allem nach dessen Tod große Popularität. Nach der Stagflation in den 1970er-Jahren traf dann Friedman mit seiner Forderung nach Rückbesinnung auf freie Märkte den Nerv der Zeit.
Als die Weltwirtschaftskrise 1929 begann, war der britische Ökonom John Maynard Keynes (* 1883; † 1946) bereits in der Verwaltung, als Publizist und am King’s College in Cambridge tätig. Ökonomie hatte er dort einst bei Alfred Marshall studiert, einem Vertreter der neoklassischen Wirtschaftstheorie (siehe auch AnlegerPlus, Ausgabe 6/2021).
Magie der Globalsteuerung
In den neoklassischen Modellen fand Keynes jedoch keine Antwort auf die Wirtschaftskrise. Trotz sinkender Preise und Löhne wollte sich die Wirtschaft in vielen Ländern – insbesondere in den USA und Deutschland – im Gegensatz zur Theorie der Neoklassiker einfach nicht stabilisieren. Die Arbeitslosigkeit stieg rasant.
Keynes verfügte über Erfahrung als politischer Berater und war an der Börse – mal mehr, mal weniger erfolgreich – tätig. Deshalb überrascht es kaum, dass er psychologische Elemente in seine Wirtschaftstheorie einfügte. Nach Keynes seien Konjunkturschwankungen auf eine instabile Nachfrage zurückzuführen. Damit wandte er sich gegen die gängige neoklassische Annahme, ein Gleichgewicht würde sich automatisch durch Preisänderungen wieder einstellen.
Insbesondere die Nachfrage der Unternehmen nach Investitionsgütern sei schwankungsanfällig, so Keynes. Pessimistische Wirtschaftsaussichten würden Investitionen verhindern. Mit sinkender Produktion schrumpfen auch die Einkommen der Arbeitnehmer und es werde dann weniger gekauft. Da sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage aus privatem Konsum, Investitionen der Unternehmen, Exporte abzüglich der Importe sowie Staatsausgaben zusammensetzt, könne der Staat diese Spirale nach unten mit einer antizyklischen Wirtschaftspolitik, auch nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik genannt, durchbrechen.
In einer Rezession solle der Staat somit seine Ausgaben – den größten Effekt hätten kreditfinanzierte Investitionen – erhöhen. Die Verschuldung könne im Boom wieder abgebaut und sogar Rücklagen gebildet werden, da die Staatsausgaben dann sinken müssten.
In Deutschland kodifiziert wurde eine solch globale Steuerung 1967 im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz mit den Zielen: Stabilität des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und angemessenes Wirtschaftswachstum. Dazu wird von der Bundesregierung jährlich ein Jahreswirtschaftsbericht erstellt, der zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates ebenfalls Stellung nimmt. Den unterschiedlichen Finanzbedarf soll eine Konjunkturausgleichsrücklage abpuffern.
Obwohl fiskalische Maßnahmen durch das Gesetz schneller umgesetzt werden konnten, hat es seit Mitte der Siebzigerjahre seine Bedeutung verloren. Die späteren Konjunkturprogramme wurden nicht auf Grundlage des Stabilitätsgesetzes beschlossen, denn es fehlte oft an Passgenauigkeit für die Eingriffe in den Wirtschaftsprozess. Zudem waren die als magisches Viereck bekannten Ziele nicht immer in Einklang zu bringen.
Auf alle Fälle regelgebunden
In Konflikt stand etwa die gleichzeitige Verringerung von Arbeitslosigkeit und Inflation. Die sogenannte Phillipskurve zeigte in ihrer abgewandelten Form, dass geringe Arbeitslosigkeit mit hohen Inflationsraten korrelierte. „Lieber fünf Prozent Inflation als fünf Prozent Arbeitslosigkeit“, hieß es noch in den frühen Siebzigerjahren.
Das sei aber nicht von Dauer, wandte später der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman (* 1912; † 2006) ein, denn höhere Inflationsraten würden langfristig immer eingepreist. Er prägte wie kein anderer Ökonom sein Fach an der Universität von Chicago. Seine Theorien eroberten später als Monetarismus die Welt. Friedman lehnte diskretionäre, also fallweise, Eingriffe in die Wirtschaft ab. Vielmehr war er der Ansicht, dass der Staat mit seiner unsteten Steuer- und Ausgabenpolitik Störungen oft noch verstärken würde. Allein ein am Produktionspotenzial orientiertes und somit regelgebundenes Wachstum der Geldmenge sei nötig, damit die Wirtschaft stabil wachsen könne.
Mit der US-amerikanischen Ökonomin Anna Schwartz wertete Friedman empirische Daten zur Weltwirtschaftskrise 1929 aus. Im Gegensatz zu Keynes kam er auf Basis dieser Auswertung zu dem Schluss, dass damals die US-Notenbank zur Schwere der Depression mit ihrer restriktiven Geldpolitik wesentlich beigetragen habe.
Als in den 1970er-Jahren der Ölpreis stark anstieg (Ölkrise), die Konjunkturprogramme aber nicht richtig zünden wollten, sondern nur die Preise weiter explodierten, kam die Stunde des Monetarismus und ihrer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Sie setzte auf verbesserte Bedingungen für den privatwirtschaftlichen Sektor. Der Staat war hauptsächlich auf ordnungspolitische Aufgaben reduziert.
Thatcherism, Raeganomics, Chicago Boys in Chile
Wie Keynes war Friedman auf politischer Bühne zu Hause und seine Auftritte legendär. Viele Regierungschefs stützten sich auf seine Theorien. Insbesondere unter Margaret Thatcher (von 1979 bis 1990 britische Premierministerin) und Ronald Reagan (40. US-Präsident von 1981 bis 1989) wurde die Wirtschaft stark dereguliert und staatliche Leistungen abgebaut.
Der Berater von Ronald Reagan, der amerikanische Ökonom Arthur Laffer, argumentierte, dass mit zunehmender Besteuerung die Motivation, Einkommen zu erzielen, abnehme. Als dann aber in den USA die Spitzensteuersätze gesenkt wurden, verdreifachte sich die Staatsverschuldung in Reagans Amtszeit nahezu.
Zum Versuchslabor einer angebotsorientierten Schocktherapie wurde schließlich Chile. Friedman selbst war jedoch nie direkter Berater der Militärdiktatur Pinochets, die von 1973 bis 1990 andauerte. Eine Gruppe von Ökonomen, die aufgrund ihrer Verbindung zu der Universität von Chicago auch Chicago Boys genannt wurden, wollte die chilenische Wirtschaft damals allerdings gemäß den Lehren Friedmans reformieren. Die Wirtschaft dort lag am Boden und es herrschten starke soziale Spannungen.
Zwar konnte die galoppierende Inflation dadurch zunächst eingefangen werden, allerdings brach die Wirtschaftsleistung anfangs stark ein und wuchs anschließend nur mäßig. Zurück blieb eine extreme Ungleichheit.
Es war übrigens Walter Eucken (* 1891; † 1950), der den Begriff Ordnungspolitik geprägt hatte. Er war überzeugt, dass der Staat nur die Spielregeln, also den Ordnungsrahmen, festlegen solle. Eucken war damit Mitbegründer des Ordoliberalismus und einer der geistigen Väter der Sozialen Marktwirtschaft. Staatliche Aufgabe sei es, durch Ordnungspolitik Wettbewerb und Freiheit an den Märkten sicherzustellen sowie Privilegien und Machteinflüsse zu verhindern. Nicht immer gelang dies, wie beispielsweise die Finanzkrise 2008 zeigte.
Foto: © Image_Source_ – istockphoto.com